Startseite > Wissenswertes > Zum Thema Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftlichkeit ist kein Zauberwerk
Um die Wirtschaftlichkeit im Pflegedienst sicherzustellen, gibt es verschiedene Stellschrauben. Die „Big Five“ zu kennen, hilft, am Ende des Monats schwarze Zahlen zu schreiben und langfristig den Betrieb abzusichern.
Alle reden von Krisen und Existenzangst der Pflegedienste (PD) – zu Recht! Jammern hilft aber nicht. Einen PD zu betreiben ist eine anspruchsvolle Aufgabe und trägt auch dazu bei, für die Gesellschaft Gutes zu tun. Denken Sie positiv. Es gibt eine überschaubare Anzahl von Ansätzen, einen PD wirtschaftlich zu führen – hier ein Überblick. Darüber wird zu reden sein.

Dieser Beitrag richtet sich insbesondere an diejenigen, die sich der Aufgabe stellen, auch in Zukunft einen PD verbunden mit allen Schwierigkeiten, weiter betreiben zu wollen. Sie werden sehen, an einigen wichtigen Stellschrauben zu drehen, bringt den notwendigen Erfolg. Hierzu möchte ich einen Überblick mit praktischen Umsetzungsempfehlungen geben.
Schwerpunkt der Betrachtung in diesem Beitrag ist das operative Controlling, verbunden mit der Frage: Tun wir die Dinge richtig? Hier kann in den meisten PD schnell gehandelt werden.
Prüfend und strategisch denken
Das strategische Controlling muss sich anschließen, kann aber auch parallel betrachtet werden. Dabei geht es um die Frage: Tun wir die richtigen Dinge? (Beratungen, Hauswirtschaft, Schulung von Angehörigen, Tagespflege, Wohngemeinschaften, vergrößern, konsolidieren, Privatkunden, SHPV)
Die Big Five zur Steuerung der Wirtschaftlichkeit
Dies sind die Big Five der Stellschrauben zur Steuerung der Wirtschaftlichkeit:
1. a) Kundenaufnahme und b) Beratungsbesuche beim Kunden
2. Touren- und Einsatzplanung (verbunden mit der Vorkalkulation)
3. Controlling (hier verbunden mit der Nachkalkulation)
4. Rechnungen schreiben/ kontrollieren/ den Kunden vor Augen haben
5. Leistungsrecht/Kenntnis der Leistungsinhalte/Durchsetzung der Entgelte
Zu 1a: Bedenken Sie, der PD nimmt einen Auftrag/Kunden an, der über einen längeren Versorgungszeitraum betreut wird. Sie stellen bereits bei der Aufnahme und/oder nach der ersten Evaluation die Weichen für eine effektive Pflege (über einen langen Zeitraum), da müssen Zeiteinsatz und Entgelt von Anfang an stimmen. Erstellen Sie ein „pflegerisches Angebot“, in dem Sie den gesamten Bedarf des Kunden ermitteln. Das ist Ausgangspunkt Ihres Angebotes. Klären Sie gemeinsam mit dem Kunden und Angehörigen, welche Bedarfe durch die Angehörigen sichergestellt werden können.
Zu 1b: Die (abrechenbaren) Beratungsbesuche nach§ 37 (3) SGB XI schließen sich dieser Überlegung an. Bieten Sie diese auch systematisch Ihren „Sachleistungskunden“ und Kunden mit Kombinationsleistungen an. Machen Sie aus dem für die Versorgung wichtigen Einsatz auch einen „betriebswirtschaftlichen Einsatz“ und passen Sie nach Notwendigkeit Leistungen und Zeiteinsalz an. Erstellen Sie ein „pflegerisches Angebot“, in dem Sie den gesamten Bedarf des Kunden ermitteln. Das ist Ausgangspunkt Ihres Angebotes. Klären Sie gemeinsam mit dem Kunden und Angehörigen, welche Bedarfe durch die Angehörigen sichergestellt werden können.
Zu 2: Angesprochen wird in diesem Zusammenhang insbesondere der „richtige“ Stundenkostensatz für den Außendienst. In dieser Reihenfolge wird vorkalkuliert und gerechnet:
• 2.1. Kostendeckende Zeitermittlung pro Leistungskomplex
• 2.2. Kostendeckender Einsatz beim Kunden
• 2.3. Kostendeckende Versorgung monatsbezogen (siehe auch „Nachkalkulation“)
• 2.4. Kostendeckende Tour Kostendeckung in obigem Zusammenhang soll heißen, einschließlich der Aufschläge für Risiko, Rücklage und Gewinn.
Es wird bei der Kalkulation eine Zielgröße „notwendige Einnahme“ pro Zeiteinheit (Stunde, Minute, Einsatz) festgelegt. Grundlage bzw. Basis für die Einsatzkalkulation ist der Stundenkostensatz (Kosten eines Mitarbeiters im Außendienst). Diesen können Sie im Rahmen einer Divisionskalkulation errechnet werden (Siehe Tabelle I unten).
Für das differenzierte Controlling bedarf es einer weiteren Unterteilung der Kosten nach Personalqualifikation. Hierauf wird an dieser Stelle nicht eingegangen. Wichtig ist, das Grundprinzip und die Hilfsmittel hierzu zu kennen.
Wenn schon bei der Vorkalkulation Fehler gemacht werden, hilft auch das Instrument der Nachkalkulatlon wenig.
Anmerkung: Das vorgestellte Berechnungsschema gilt so auch für die Vorlage der Kosten im Rahmen von Vergütungsverhandlungen.
Praxishinweis: Berechnen Sie den Stundenkostensatz anhand der Unterlagen 2023 (insbesondere für die Sachkosten). Anpassungen für 2024 sind entsprechend veränderter Kostenstrukturen notwendig. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie zu folgenden Ergebnissen kommen:
-
Stundenkostensatz „Examinierte“ € 65,00 +
-
Stundenkostensatz „Einjährige“ € 55,00 +
-
Stundenkostensatz „übrige“ € 45,00 +
Da liegen Sie richtig. Der jeweilige Stundenkostensatz wird eher höher sein.
Zu 2.1.: Leistungskomplexe (LK) – so kann gerechnet werden:
- a) Den Stundenkostensatz rechnen Sie um auf eine Minute (Minutenwert)
- b) Das Entgelt für einen LK teilen Sie durch den .Minutenwert“ (a)
- c) Das Ergebnis ist die maximale Zeit für den LK
- d) Das Ergebnis zu c) passen Sie ggf. ihrem Erfahrungswert an
Hinweis: Vermeiden Sie die „Durchschnittsfalle“, so Andreas Heiber. Die individuelle Zeit auch für einzelne Verrichtungen sind kundenspezifisch unterschiedlich (siehe auch 2.2.).
Zu 2.2.: Einsatz – so kann gerechnet werden:
- a) Entgelt für die Einsätze geteilt durch Minutenwert zu oben
- b) Das ergibt den möglichen maximalen Zeiteinsatz
- c) Diesen passen Sie je nach Möglichkeit an, nach unten
Klarstellung: Es geht hier nicht unbedingt um die Umsetzung der „vergütungsorientierten Einsatzplanung“, sondern darum, einen wirtschaftlichen, zeitlichen Rahmen zu kalkulieren.
Zu 2.3.: Tour – so kann gerechnet werden:
- a) Geplante Entgelte und Kosten werden gegenübergestellt.
- b) Wenn keine Kostendeckung vorliegt, muss analysiert und angepasst werden.
| Formel | Unterlage/Hilfsmittel | Zahlenbeispiel |
|---|---|---|
| Personalkosten Pflege SGB XI, geteilt durch Einsatzzeiten Außendienst SGB XI | aus der Lohnbuchhaltung | 420.000,00 € |
| Durch Einsatzzeiten Außendienst SGB XI | PD-Software | 12.000 |
| ergibt Personalkosten Pflege SGB XI in der Std. Außendienst | 35,00 € |
|
| Personalkosten „Büro“, geteilt durch sämtliche Einsatzzeiten Außendienst | aus der Lohnbuchhaltung | 180.000 € |
| Sämtliche Einsatzzeiten Außendienst | PD-Software | 20.000 |
| ergibt Personalgemeinkosten in der Std. Außendienst | 9,00 € | |
| Sachkosten geteilt durch Einsatzzeiten Außendienst | aus der Finanzbuchhaltung bzw. Kostenrechnung | 180.000 € |
| Einsatzzeiten Außendienst | PD-Software | 20.000 |
| ergibt Sachgemeinkosten in der Std. Außendienst | 9,00 € | |
| ergibt Selbstkosten in der Std. Pflege | 53,00 € | |
| zuzüglich Risiko/Rücklage/Gewinn (6%, besser mehr ansetzen) | 3,18 € | |
| ergibt zu erwirtschaftendes Entgelt im Außendienst in der Stunde / Zielgröße | 56,18 € |
Tabelle 1: Stundenkostensatz 5GB XI: Die Zahlenbeispiele sind keine Empfehlung, sie dienen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
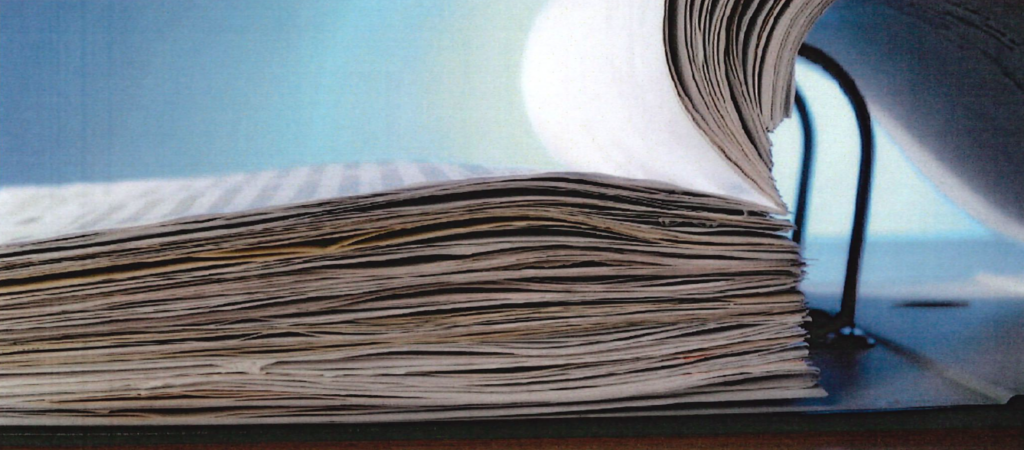
Zu 2.4.: Kunde – so kann gerechnet werden:
- a) Geplante monatliche Entgelte und Kosten werden gegenübergestellt.
- b) Wenn keine Kostendeckung vorliegt, muss analysiert und angepasst werden.
Zu 3.: Controlling/Nachkalkulation
Über die Zeit-Leistungserfassung wird im Nachhinein der jeweilige Überschuss oder die Unterdeckung ausgewertet. Die Nachkalkulation zeigt das reale tatsächliche wirtschaftliche Ergebnis, nach Einsatz, nach Tour und besonders wichtig nach Kunde. Der ggf. unwirtschaftliche Einsatz ist auf deren Ursache zu hinterfragen. Die Tourenanalyse ist selbstverständlich täglich vorzunehmen, um zeitnah eingreifen zu können (Verweis u.a. auf unten: Fahrtzeiten). Im Fokus steht der Auftrag insgesamt – die Versorgung des Kunden. Die EDV wird (muss) für Sie wie folgt den monatsbezogenen Gewinn bzw. Verlust pro Kunde berechnen:
Entgelte für den Kunden – Kosten für den Kunden (erbrachte Zeit für den Kunden x Stundenkostensatz) = Gewinn oder Verlust (Über- oder Unterdeckung).
Es muss klar sein: Wenn schon der vorab gerechnete Stundenkostensatz nicht korrekt ist, hilft Ihnen obige Berechnung nicht, schlimmer noch, Sie erhalten eine falsche Information mit der Folge, sich in falscher Sicherheit zu wiegen, vermeintlich wirtschaftlich zu arbeiten.
In letzter Konsequenz ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Auftrag, die Kundenversorgung, monatsbezogen, wirtschaftlich ist. Sich rechnerisch die Über- und Unterdeckungen bei der Tour kundenbezogen zeigen zu lassen, ist das eine, hieraus entsprechende Maßnahmen (Zeit-und Leistungsanpassungen) einzuleiten, das andere – die eigentliche Arbeit!
Der PD kann sich auf Dauer keine nicht kostendeckenden Versorgungen und/oder Kunden erlauben.
Zu 4.: Rechnungswesen – Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. In der Praxis hat sich bewährt, dass die Sichtung der „geschriebenen“ Rechnungen eine „letzte“ Kontrolle für die korrekte Abrechnung aller Leistungen ist. Mittels EDV-Einsatz und gestrafftem Prozess liegen diese zeitnah vor. Es geht bei dieser Prüfung nicht nur um rechnerische Zusammenhänge, sondern darum, bei Einsicht der Rechnung den Kunden „vor sich zu sehen“. Ein geschultes Auge wird „mit Hand auflegen“ erkennen, ob Leistungserbringung und Abrechnung zusammenpassen.
Zu 5: Rund ums Leistungsrecht in Anknüpfung zu oben, Frage und Anmerkungen. Werden die „richtigen“ Leistungen abgerechnet? Setzen Sie Ihren Anspruch auf die erbrachte Leistung bei ungerechtfertigten Kürzungen gegenüber den Krankenkassen durch. Berechnen Sie die betriebsnotwendigen (nicht pauschal regional üblichen) Investitionskosten (auch gegenüber den Sozialhilfeträgern) und setzen Sie diese durch. Nutzen Sie die möglichen Abrechnungsmöglichkeiten, wie stundenweise Verhinderungspflege, Beratungseinsätze auch bei Ihren Sachleistungskunden und mehr. Berechnen Sie die Leistung bei Absage des Pflegeeinsatzes durch den Kunden im Rahmen des Pflegevertrages.
Was passiert wo?
Soweit ein Ansatz. Ein weiterer ggf. sich überschneidender Ansatz ist die Hinterfragung bei den Tätigkeiten bzw. in den Betriebsbereichen des PD, verbunden mit der Frage, was passiert wo richtig und oder falsch? Diese Fragen klären wir in der Juli-Ausgabe von Häusliche Pflege, wenn wir uns die betriebswirtschaftlichen „ Tatorte“ anschauen.
Dieser Artikel stammt von Rainer Berg, Dipl. Betriebswirt und Steuerberater. Laden Sie sich den kompletten Artikel als PDF herunter: PDF-Download
