Startseite > Wissenswertes > Was die IT leisten kann
Was die IT leisten kann
Eine gute digitale Analyse und Steuerung von Pflegedienst-Daten kann die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens verbessern. Dabei sollte klar sein, welche Bereiche mit Hilfe von Software wie verstanden und ausgewertet werden können.
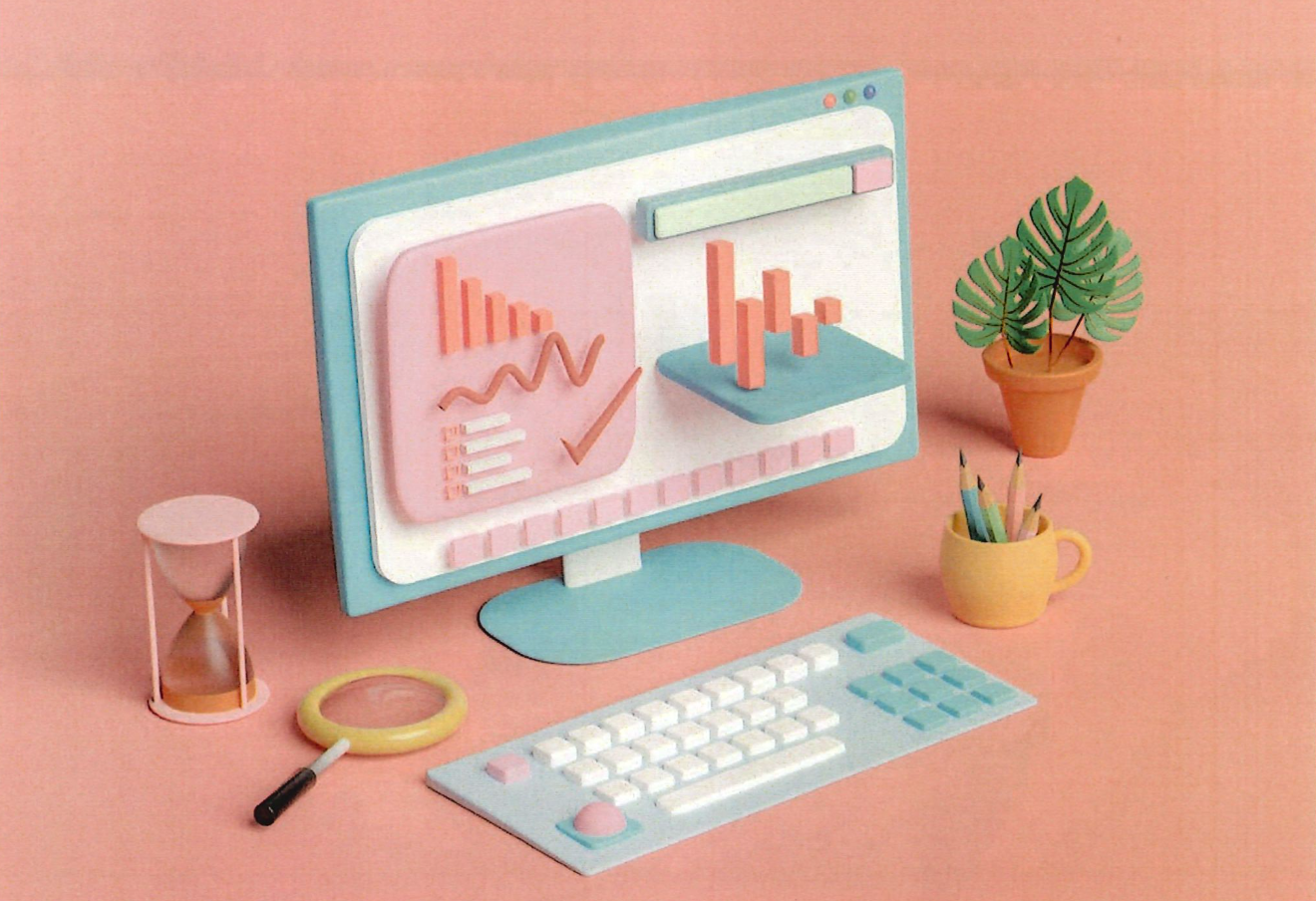
Folgende Bereiche werden angesprochen:
- (A) Überschüsse/Unterdeckungen
- (B) Erbrachte Leistungen
- (C) Rund ums Personal
- (D) Zusammenwirken der Bereiche
- (E) Weitere Pflichtauswertungen – informativ
Bei Punkten A) bis C) geht es um Auswertungen der Wirtschaftlichkeitssteuerung im engeren Sinne.
Eingeschränkt kann die PD-Software auch Aussagen (und Kennzahlen) über die Wirtschaftlichkeit des PD insgesamt liefern. Diese Analyse ist über die Auswertung einer qualifizierten BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung) umfassend ggf. besser möglich. Hierüber wird gesondert berichtet.
Die Analyse der Aufträge nach Deckungsbeitrag ist und bleibt die wichtigste Auswertung.
A) Überschüsse und Unterdeckungen
Die wichtigste Auswertung zeigt die Wirtschaftlichkeit des Auftrages – monatsbezogen. Die Vorkalkulation steht, der Kunde ist mit Einsatzzeiten eingeplant – natürlich mit Hilfe der IT. Es folgt die Kontrolle – in Form einer ABC-Analyse. Dies unter dem Gesichtspunkt der Deckungsbeitragsrechnung. Letzteres bedeutet vereinfacht umschrieben: „was bleibt übrig nach…“. Die ABC-Analyse zeigt nach Informationswunsch (Tour, Kunde, Mitarbeiter) auf, ob die Leistungserbringung kostendeckend erfolgte.
An einem Beispiel zu Kunden (Abb. 1, S. 42) wird der Aufbau und die Aussage deutlich.
Schritt 1: Mit dem „Patienten“ mit der Kundennummer 1030 wird ein Umsatz in Höhe von 1.502,39 Euro erbracht.
Schritt 2: Nach Personalkosten (Pflegepersonal 990,85 Euro – hier nicht angezeigt) ergibt sich ein Deckungsbeitrag (DB) I. Was bedeutet, dass nach Abzug der Personalkosten („im Einsatz“) 511,54 Euro übrigbleiben.
Schritt 3: Beim DB II werden zusätzlich die Overheadkosten (Personal- und Sachgemeinkosten) vom Umsatz abgezogen – übrig bleiben danach 1,96 Euro.
Schritt 4: Die Berechnung des DB III beinhaltet den angestrebten Aufschlag für Risiko, Rücklage und Gewinn. Im Ergebnis wird bei diesem Kunden eine Unterdeckung von 88,07 Euro erzielt.
Die IT rechnet im Hintergrund nicht sichtbar und zeigt nur die Ergebnisse. Hinterlegt sind die Kosten aus dem Beitrag I (35,00 Euro, 53,00 Euro, 56,18 Euro) – unterstellte Einsatzzeit hier 28,31 Minuten.
Warum diese differenzierte Betrachtung nach DB? Diese dient u. a. der wirtschaftlichen Einschätzung einzelner Aufträge. So die Bewertung: Der DB I muss immer positiv sein, ansonsten wären die Pflegepersonalkosten höher als die Einnahmen aus dieser Versorgung.
Die differenzierte Betrachtung nach Deckungsbeitrag erlaubt bessere Entscheidungen.
Der DB II zeigt an, ob auf Vollkostenbasis alle Kosten über die Einnahmen refinanziert werden. In Einzelfällen kann ein Auftrag auch dann (vorübergehend) angenommen werden, wenn nur anteilig Gemeinkosten (GK) mitgetragen werden.
Der DB III zeigt, ob das kalkulierte Ziel (mit Gewinnrealisierung) erreicht wurde. Bei einer „schwarzen 0“ wäre dies der Fall. Nun ist es in der Praxis so, dass es nur in den seltensten Fällen eine Punktlandung geben wird. Insoweit bleibt es bei einer Mischkalkulation.
Zusammenfassend hierzu folgende Anmerkungen:
- Ohne eine solche Analyse ist eine Steuerung der wirtschaftlichen Versorgung nicht möglich.
- Es müssen die richtigen StdKS hinterlegt sein (Verweis Teil I).
- Die Summe aller Versorgungen muss positiv sein.
- Es bleibt die Frage, wie viel und in welchem Umfang kann sich der PD unwirtschaftliche Versorgungen/Kunden leisten?
Eine solche Analyse wird oft umsatzbezogen aufgestellt, nach dem Motto: der Auftrag mit dem größten Umsatz ist der beste. Diese Aussage ist hiermit widerlegt. Im Gegenteil, ein hoher Umsatz mit einem Auftrag bedeutet Personalbindung und bei Wegfall des Auftrages eine Lücke in der Auslastung der Mitarbeiter. An dieser Stelle ließe sich auch fachlich tiefergehend diskutieren, worauf an dieser Stelle verzichtet wird.
Dargestellt werden sollte an dieser Stelle die wichtigste Wirtschaftlichkeitskennzahl, welche die IT liefern muss. Hieraus können/sollen sich Entscheidungen für die weitere Steuerung der Kundenbetreuung ergeben. Insbesondere die Aufträge mit einer Unterdeckung stehen im Visier der tiefgehenden Analyse und Anpassung.
B) Auswertungen im Leistungsbereich
Hier geht es darum, ob die Möglichkeiten der Angebote und Abrechnung ausgeschöpft werden. Hierzu einige wichtige Ansatzpunkte:
Auswertung der Ausschöpfung
- der Sachleistungen (auch nach Pflegegraden),
- der Verhinderungspflege,
- der Beratungsbesuche,
- der Zusatzleistungen,
- Leistungen nach § 45 b SGB XI
- und weitere.
Es liegt auf der Hand, dass, soweit sinnvoll für die Versorgung des Kunden, eine möglichst hohe Ausschöpfung anzustreben ist. Außerdem liefert diese Statistik die Grundlage der jahresübergreifenden Planung.
C) Personalmanagement
Die gesamte bezahlte Arbeitszeit ist nach deren Verwendung/Einsatz lückenlos zuzuordnen.
Neben der administrativen Bearbeitung (Führung der – am besten digitalen – Mitarbeiterakte) sollen Aussagen über die Aufteilung der vertraglich vereinbarten bzw. bezahlten Arbeitszeit mittels Zeiterfassung getroffen werden. Letztlich muss ersichtlich sein, wieviel Zeit der Außendienstmitarbeiter für den Außendienst zur Verfügung steht und wie die übrige Zeit zu bewerten ist.
Zur Verdeutlichung dient folgende Rechnung: Bezahlte Arbeitszeit
- Zeiten für Urlaub
- Zeiten für Krankheit
- Zeiten für bezahlte Feiertage
- Zeiten für Einarbeitung
- Zeiten für sonstige Freistellungen
- Zeiten für Dienstbesprechungen
- Zeiten für Übergabe im PD
- Zeiten für sonstige organisatorische Tätigkeiten
= Zeiten für Außendienst / Nettoarbeitszeit
davon Fahrzeiten …
Zur Kontrolle: Die gesamte bezahlte Arbeitszeit muss zugeordnet sein!
Eine solche Auswertung kann monatsbezogen erfolgen und ist Teil eines Managementinformationssystems (MIS) sowohl für die PDL als auch für die Geschäftsführung.
ABC-Analyse und Deckungsbeiträge
| Kundennummer | Umsatz | Deckungsbeitrag I | Deckungsbeitrag II | Deckungsbeitrag III |
|---|---|---|---|---|
| 1044 | 927,36€ | 484,61€ | 256,91€ | 216,68€ |
| 1046 | 1458,91€ | 673,16€ | 197,62€ | 197,67€ |
| 1028 | 1438,00€ | 609,55€ | 183,49€ | 108,22€ |
| 1043 | 725,76€ | 313,46€ | 101,42€ | 63,96€ |
| 1045 | 722,00€ | 298,15€ | 80,17€ | 41,66€ |
| 1048 | 320,00€ | 145,70€ | 56,06€ | 40,22€ |
| 1032 | 373,60€ | 159,40€ | 49,24€ | 29,78€ |
| 1042 | 376,32€ | 158,97€ | 47,19€ | 27,44€ |
| 1047 | 460,00€ | 184,20€ | 42,36€ | 17,30€ |
| 1041 | 272,16€ | 108,71€ | 24,65€ | 9,80€ |
| 1040 | 1890,83€ | 681,58€ | 59,68€ | -50,19€ |
| 1029 | 1292,23€ | 455,38€ | 25,00€ | -51,03€ |
| 1030 | 1502,39€ | 511,54€ | 1,96€ | -88,07€ |
| 1033 | 120,96€ | -10,99€ | -78,85€ | -90,84€ |
| 1036 | 1161,76€ | 376,71€ | -27,03€ | -98,36€ |
| 1034 | 417,18€ | 79,08€ | -94,80€ | -125,52€ |
| Summe | 13.459,46€ | 5229,21€ | 925,12€ | 248,73€ |
Abb. 1: Auszug aus einer Kunden-ABC-Analyse
Die Auswertung ist
- Bestandteil einer Jahresanalyse,
- Unterlage für Vergütungsverhandlungen und
- Grundlage für die Ermittlung von Stundenkostensätzen.
Zu 1.: Hinterfragt werden können z. B. Organisationszeiten, Fahrtzeiten, Zeiten für Fort- und Weiterbildung usw.
Zu 2. und 3.: Im Fokus stehen aktuell die „Overheadkosten“ (Personal- und Sachgemeinkosten). Diese sind der Finanzbuchführung (Fibu) zu entnehmen und werden mittels Divisionskalkulation (Kosten geteilt durch Nettoarbeitszeit – Verweis auf Beitrag I) auf eine Stunde im Außendienst runtergerechnet. Des Weiteren hat die Nettoarbeitszeit entscheidenden Einfluss auf die Höhe des StdKS. Je geringer die Nettoarbeitszeit bezogen auf die Bruttoarbeitszeit ist, desto höher ist der tatsächliche und zu verhandelnde StdKS.
Weitere statistische Aussagen muss die IT zu Überstunden, Minusstunden (besser keine vorhanden) und Urlaubsansprüchen liefern. Dies sowohl mitarbeiterbezogen als auch in der Gesamtheit und dies monatlich.
Die Anwendungsbereiche der IT müssen zusammenarbeiten – intern und extern.
D) Zusammenwirken und Schnittstellen
1. Touren und Einsatzplanung mit Dienstplanung, Dienstplanung mit Lohn- und Gehaltsabrechnung:
Die Personalstatistiken (ausgewertet und zusammengestellt über die Dienstplanung) zu oben (C) sind ein Teil der PD-Software und sollten im stetigen Abgleich mit dem Bereich „Touren und Einsatzplanung“ sein. So können u. a. Mitarbeitereinsatzkapazitäten permanent eingesehen werden. Lohnabrechnungsrelevante Daten können, wenn das Zusammenspiel funktioniert, in die Lohnabrechnungsabteilung digital übermittelt werden. So werden Übertragungsfehler vermieden, Arbeitszeiten eingespart u/o Gebühren bei externen Dienstleistern vermindert.
2. Abrechnungssoftware mit Finanzbuchführung (Fibu):
Mittlerweile ist es gängige Praxis, dass Ausgangsrechnungen per Schnittstelle digital an die Fibu übergeben werden. Um eine der PBV entsprechende Buchung zu gewährleisten, müssen die Fibu-Konten in der PD-Software hinterlegt sein. Offensichtlich gibt es bei Übertragung der Ausbildungsumlage bei einigen Programmen noch Probleme. Es handelt sich bei diesen Einnahmen um einen sogenannten „Durchlaufenden Posten“ und nicht um „Einnahmen“. Zum einen erfolgt hiernach eine falsche Buchung in der Fibu und zum anderen wird die BWA nicht unwesentlich verfälscht. Hier muss ggf. Abhilfe geschaffen werden. Sprechen Sie mit Ihrem Software-Vertragspartner.
E) Pflichtaufgaben
Auf die Pflichtaufgaben wird an dieser Stelle nur informativ ergänzend hingewiesen: Die Pflegedienstsoftware, soweit sie zu den Grundlagen der Rechnungsschreibung gehört, muss den Anforderungen der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Datenverarbeitung (GoBD) entsprechen. Zur Befreiung von der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer kann das Finanzamt Statistiken zur überwiegenden Kostentragung pro Kunde und in der Summe verlangen.
Eine (verkürzte) Checkliste soll einen Überblick über die wichtigsten Auswertungen und Funktionen der IT zur wirtschaftlichen Steuerung geben:
- Kostenwirtschaftliche Touren- und Einsatzplanung
- Deckungsbeiträge Einsätze
- Deckungsbeiträge Tour
- Deckungsbeiträge Kunde (siehe A)
- Abweichungsanalyse Planung und Ist (ggf. zeitbezogen)
- Anzahl der versorgten Kunden nach Einstufung SGB XI
- Anzahl der versorgten Kunden nach SGB V
- Anzahl der versorgten Kunden in Kombination zu oben
- Differenzierte Auswertung der eingesetzten Arbeitszeiten (siehe C)
- Schnittstelle zu Finanzbuchhaltung (siehe D)
- Schnittstelle zu Lohnbuchhaltung (siehe D)
- Schnittstelle Einsatzplanung & Dienstprogramm (siehe D)
- Einsatz von KI zukünftig
- Digitale Abrechnung, Dokumentation
- Digitale Abrechnung mit den Kassen
- Umsatz pro Mitarbeiter
- Ausschöpfung der Pflege-Sachleistungen und nach Pflegestufen
- Ausschöpfung/Inanspruchnahme Beratungsleistungen
- Ausschöpfung/Inanspruchnahme Verhinderungspflege
- Ausschöpfung/Inanspruchnahme der Leistungen nach § 45 b SGB XI
- Statistik einzelner Leistungen generell
- Umsatz- und Gewerbesteuerstatistik
- GoBD – Testat
Prüfen Sie, ob das von Ihnen eingesetzte Programm die wesentlichen Auswertungen und ggf. tiefergehende Auswertungen ermöglicht. Nehmen Sie Schulungen über das von Ihnen eingesetzte Programm regelmäßig in Anspruch. Diese sind am effektivsten im eigenen Unternehmen.
Dieser Artikel stammt von Rainer Berg, Dipl. Betriebswirt und Steuerberater. Laden Sie sich den kompletten Artikel als PDF herunter: PDF-Download
